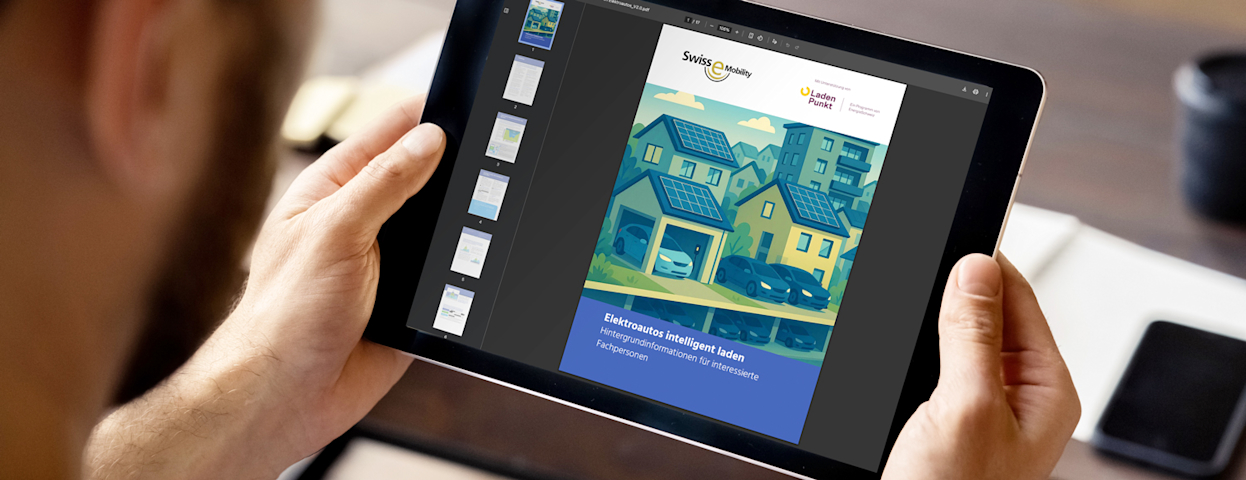Der Anteil erneuerbarer Energien im Schweizer Stromnetz wächst. Doch das birgt Herausforderungen für die Ladeinfrastruktur: Solar- und Windstrom sind wetterabhängig und liefern nicht immer dann Strom, wenn er benötigt wird.
Das zukünftige Stromsystem ist deshalb auf flexible Verbraucher angewiesen, die den Zeitpunkt und die Leistung ihres Strombedarfs an das vorhandene Angebot anpassen. Ebenso wichtig sind Speicher, die überschüssigen Strom zwischenspeichern können. Elektroautos sind beides in einem – vorausgesetzt, sie werden intelligent geladen.
Elektroautos: Flexible Verbraucher und Speicher in einem
Elektroautos stehen – wie alle Autos – durchschnittlich mehr als 95% der Zeit: nachts zu Hause, tagsüber zu Hause oder am Arbeitsplatz. Das macht sie zu besonders flexiblen Stromverbrauchern: Die Batterie muss nicht täglich voll sein, und sowohl der Zeitpunkt als auch die Geschwindigkeit der Ladung lassen sich intelligent steuern.
Hinzu kommt das Potential ihrer grossen Batterien: Sie können nicht nur flexibel Strom aufnehmen, sondern zukünftig sogar Energie ins Stromnetz zurückspeisen – genau dann, wenn sie gebraucht wird.
Die Broschüre in Kürze
Die Broschüre bietet einen kompakten Überblick über alle relevanten Aspekte des intelligenten Ladens: technische Grundlagen, Hintergrundwissen sowie konkrete, umsetzbare Praxistipps. Zentrale Themen sind:
Bildquelle: iStock und Swiss eMobility
Herausgegeben von: Swiss eMobility mit Unterstützung von EnergieSchweiz
Veröffentlicht: August 2025